Wie gendert man richtig? Sternchen, Doppelpunkt und Co.
Um Gründe für oder gegen das Gendern geht es woanders. Hier dreht sich alles darum, wie man geschlechtergerechte Sprache umsetzt. Welche Formen gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile? Und können dabei trotzdem schöne Texte rauskommen?
Genderneutrale Zeichen allgemein
Vorab: Gender-Sternchen und Doppelpunkt sind noch nicht Teil der amtlichen Rechtschreibung. Dennoch ist laut Duden „zu beobachten, dass sich die Variante mit Genderstern in der Schreibpraxis immer mehr durchsetzt“. Beide Formen zeigen an, dass die schreibende Person außerhalb des binären Geschlechtermodells von männlich und weiblich denkt. Alle Menschen werden angesprochen.
Gender-Regel 1: Kreativ sein
Gendern ist Teil des Sprachwandels, die unterschiedlichen Möglichkeiten werden immer noch ausgehandelt. Keine Variante des Genderns deckt bisher alle sprachlichen Zweifelsfälle perfekt ab. Geschicktes Gendern heißt daher oft: Eine clevere Mischung führt zum Ziel.
Gender-Sternchen bzw. Asterisk
Das Gender-Sternchen steht meist zwischen der männlichen Grundform eines Substantivs und der weiblichen Endung: Glückskeksautor*in, Strandtester*in. Im Plural (Mehrzahl) ist es eine platzsparende Option, alle Menschen gleichermaßen anzusprechen oder abzudecken:
Bewerber*innen melden sich bei …
Professionelle Schwanzähler*innen müssen gern an der frischen Luft arbeiten.
Schwierigkeiten entstehen oft im Singular (Einzahl), denn auch ein gendergerecht formulierter Text sollte flüssig laut zu lesen. Hat man einen bestimmten Artikel (der, die, das) oder spezifische grammatische Fälle, wird das fast unmöglich. NICHT daheim nachmachen:
Ich muss den*die neue*n Nachbar*in anrufen.
Mit einem*r Florist*in sollten Sie rechtzeitig vor der Hochzeit sprechen.
Probleme gibt es auch mit Formen, bei denen sich der Vokal von männlicher zu weiblicher Form verändert: Bäuer*in (von „der Bäuer“?), Ärzt*in … Oft ist es lesefreundlicher, dann auf eine andere Variante des Genderns zu wechseln.
Gender-Regel 2: Verständlichkeit trumpft
Wenn der Text durch ungeschicktes Gendern missverständlich oder schwer lesbar wird, gewinnt niemand. Also: nicht starr an nur einem Konzept festhalten. Lieber im Einzelfall vom Plan abweichen, ein wenig in der Methodenkiste wühlen und einen schönen Text erschaffen.
Gendern mit Doppelpunkt
Die Umsetzung ist die gleiche wie mit Asterisk (Angler:in, Apfel-Etikettierer:innen). Auch die Vor- und Nachteile sind zum Großteil die gleichen: platzsparend und im Plural meist unkompliziert, im Singular teils fragwürdig.
Der Doppelpunkt fällt grafisch weniger auf als das Gender-Sternchen, schafft also für viele ein angenehmeres Schriftbild. Allerdings könnte er Menschen ausschließen: Dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) zufolge sind zwar alle Genderzeichen für Blinde und Sehbehinderte anstrengend. Wenn es ein Zeichen sein muss, spricht er sich sich allerdings für den Genderstern aus. Dafür ist auch der Bundesverband Trans*.
Gendern mit Binnen-i
Das Binnen-i (SchmetterlingssammlerInnen) wird in den letzten Jahren nur noch selten in freier Wildbahn gesehen. Es hat den Nachteil, dass es nur Männer und Frauen anspricht. Da ist fast schon egal, dass ein großes i genauso aussieht wie ein kleines l …
Beidnennung und Schrägstrich
Im amtlichen Sprachgebrauch korrekt ist die Beidnennung von weiblicher und männlicher Form. Alternativ hängt man die weibliche Endung mit Schrägstrich an: Besucher/-innen. Ein Nachteil dieser Formen: Sie ignorieren nonbinäre bzw. genderqueere Leute. Die konsequente Beidnennung („Seeigelforscherinnen und -forscher“) kostet außerdem gerade im Print wertvollen Platz und kann beim Lesen ermüden.
Genderneutrale Formen
Wer grafische Signale umgehen und dennoch alle ansprechen will, kann genderneutral formulieren. Das geht durch alternative Wörter:
„Ich bin ein Fan von guten Formulierungen“ statt „Freund von“
„Beschäftigte“ oder „Teammitglieder“ statt „Mitarbeiter“ oder „Kollegen“
„Langfinger“ statt „Dieb“
Beim Finden alternativer Begriffe hilft das famose Online-Wörterbuch Geschickt gendern. Genderneutral schreiben geht auch durch Partizipbildung:
„Studierende“ statt „Studenten“
„Teilnehmende“ statt „Teilnehmer“
… oder indem man Substantive in Verben auflöst bzw. Leute direkt anspricht. Liest sich oft auch freundlicher:
„Schicken Sie Ihre Bewerbung an …“ statt „Bewerber melden sich bei“
„Hier erwartet Sie ein buntes Potpourri an Gerüchen, Farben …“ statt „Besucher erwartet ein …“
Außerdem kann man auf die Sache statt auf die Person gehen:
„In der Physiotherapie lernen Sie hilfreiche Übungen.“
statt „Von einem*r Physiotherapeut*in lernen Sie hilfreiche Übungen.“
Gender-Regel Nr. 3: Gendern von Anfang an mitdenken
Gerade bei engen Layouts ist es schwer, erst nachträglich zu gendern. Wer es von Anfang an mitdenkt, kann viel schönere Texte erschaffen. Statt immer „Polizist“ zu schreiben, formuliert Felix Bölter es z. B. in diesem ZEIT-Artikel so:
„Ehe man das erste Mal eine Polizeiuniform anzieht, hat man also einen mehrstufigen Auswahlprozess durchlaufen. Ich behaupte: In den Streifenwagen der Republik sitzen daher weit überdurchschnittlich wertkonservative oder konservativ-liberale Menschen.“
Weibliche, männliche und geschlechtsneutrale Formen abwechseln
Auch so kann man das generische Maskulinum (ausschließlich männliche Bezeichnungen) aufbrechen: indem man Formen abwechselt. Am besten immer entgegen dem gängigen Stereotyp.
Ingenieurin, Erzieher oder Design-Profi: Bei den Berufswochen der Luise-Pusch-Grundschule lernen Schulkinder die unterschiedlichsten Jobs kennen.
Das Abwechseln klappt am besten in solchen engen Aufzählungen. Stehen die zentralen Wörter zu weit auseinander, verwirrt es beim Lesen. Das passiert, wenn oben auf der Seite von „Arbeitern“ die Rede ist und erst auf der nächsten Seite von „Arbeiterinnen“. Viele werden davon ausgehen, dass „Arbeiterinnen“ dann nur Frauen meint.
Gender-Regel Nr. 4: Die Übung macht’s
Je öfter man Wege sucht, generisches Maskulinum zu umgehen, desto leichter wird es. Und desto mehr Spaß macht es! Gendern erfordert einen spezifischen Blick. Den kann man sich antrainieren – und dadurch lesenswerte Texte schaffen, die alle Menschen ansprechen.
Tipps zum Weiterlesen:
Genderleicht & bildermächtig. Exzellente Handreichung des Deutschen Journalistinnen-Bundes
Geschickt gendern: Online-Genderwörterbuch zum Nachschlagen einzelner Begriffe
Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich gendern. Duden 2022. Überblicksbuch des Duden-Verlags. Diese Auflage enthält – im Gegensatz zu „Richtig gendern“ von 2017 – auch Tipps zum Umgang mit Asterisk & Co.
Lann Hornscheidt & Ja’n Sammla – Wie schreibe ich divers? Wie spreche ich gendergerecht? w_orten & meer 2021. Für Fortgeschrittene. Nach der praktischen Einführung folgen Überlegungen dazu, wie genderneutrale Sprache in Zukunft auch aussehen könnte.
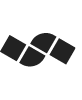




No Comments