Wie geht Fahnenkorrektur bzw. Schlussredaktion?
Das Buch ist fertig gesetzt, das Magazin soll in den Druck, die Broschüre wurde abgesegnet –was jetzt? Ist ein Text fertig gelayoutet, kommt die Fahnenkorrektur bzw. Schlussredaktion. Aber auf was muss man dabei achten?
Die gute Nachricht: Fahnenkorrektur ist nicht kompliziert. Die schlechte: Sie ist ein wenig zäh. Schließlich hat man in der Regel wenig Zeit, macht aber ziemlich gleichförmige Dinge, bei denen die Konzentration nie nachlassen darf.
In Momenten der Verzweiflung hilft, sich an den Grund zu erinnern: Fahnenkorrektur soll Verlesen verhindern. Alles, was irritiert oder ganz irreführt, fliegt raus. Inhaltliches wurde (hoffentlich) schon im Lektorat oder Redigat geklärt. Jetzt geht es um praktische, handfeste Sachen.
Trennungen
Eigentlich simpel: Ist der Text am Zeilenumbruch korrekt getrennt? Schaut man aber eine Stunde lang nur auf Worttrennungen, dreht sich alles im Kopf. Plötzlich wirkt jede zweite Trennung irgendwie … seltsam.
Dann helfen zwei Websites: der Online-Duden, der zwischen allen zulässigen Trennungen und der Duden-Empfehlung unterscheidet. Einfach Wort eingeben, anklicken, runterscrollen zu Worttrennung. Und der wundervolle Service von korrekturen.de, der weniger Klickarbeit erfordert. Für alle, die es eilig haben: https://www.korrekturen.de/worttrennung/
Sinnvoll sollten die Trennungen auch sein. Was Verlesepotenzial hat, wird geändert:
„Urin-stinkt“ hat zwar Unterhaltungswert, lenkt aber vom Inhalt des Texts ab.
Außerdem sollten nicht zu viele Trennungen aufeinander folgen. Bei langen Zeilen nicht mehr als drei, bei kurzen Zeilen wie im Wörterbuch nicht mehr als fünf.
Auch beim Umblättern einer Seite sollte man im Idealfall nicht trennen. Das erschwert das Lesen – und das wollen wir ja nicht.
Umbrüche
Seit Romeo und Julia wissen wir: Verliebte soll man nicht auseinanderreißen. Das Gleiche gilt für Zahlen und Einheiten. Nicht so schön ist, wenn am Ende einer Zeile „3“ und am Beginn der nächsten „Kilo“ steht. Das Gleiche gilt für Abkürzungen wie z. B., e. V. oder d. h. In einer perfekten Welt werden die allerdings ohnehin von einem kleinen Festabstand zusammengehalten.
Verliebte soll man nicht auseinanderreißen. Das Gleiche gilt für Zahlen und Einheiten.
Wo dürfen Gedankenstriche stehen? Nicht zu Beginn einer Zeile, weil sie dort das Schriftbild stören. Ausnahme: Wenn Gedankenstriche – so wie hier – einen Gedanken paarig umklammern. Dann sollten sie nicht durch den Umbruch von dem Wort getrennt werden, auf das sie sich beziehen. Sie dürfen dann also auch am Zeilenanfang stehen, wenn die Bezugsworte dort beginnen.
A propos Zeilenanfang: Wenn mehrere Zeilen gleich beginnen, verrutscht man beim Lesen leicht mal in der Zeile. Da also der Herstellung sagen: bitte anders umbrechen. Ich bin aus ähnlichen Gründen auch kein Fan von gleichen Zeilenenden.
Tipp: Einmal links nur über die Zeilenanfänge von oben nach unten fliegen. Wiederholt sich was? Das springt ins Auge. Danach die Seite auf der rechten Seite von unten nach oben durchgehen und nur die Trennungen lesen.
Dieser Trick hält davon ab, immer wieder in den Text reinzugehen und mehr als ein, zwei Wörter zu lesen. Das spart Zeit – und verhindert Fehler. Denn wenn man den Text wieder zu lesen beginnt, liegt der Fokus nicht mehr nur auf Umbruch und Trennungen.
Satzfehler
Witwen dürfen nicht sein, Waise sind immer öfter erlaubt.
Was das heißt? Versteht man am besten mit Bild, deshalb verweise ich an dieser Stelle auf den Wikipedia-Eintrag zu Witwen und Waisen (und ja, ich vermeide gerade absichtlich ein fieses Wort).
Abgleich Inhaltsverzeichnis
Es ist klar von Vorteil, wenn die Überschriften im Inhaltsverzeichnis mit den Überschriften im späteren Text übereinstimmen. Das gleiche gilt für die Seitenzahlen, da bin ich konservativ.
Profitipp: Lesbare Seitenzahlen rocken.
Gerade bei Layouts mit vielen Bildern also einmal durchscrollen, ob man alles erkennen kann. Vielleicht muss auf manchen Seiten die Farbe der Seitenzahl angepasst werden. Dabei gleich unauffällig checken, ob richtig gezählt wurde und ob die Zahlen zwischendrin einfach aufhören (alles schon gesehen).
Kolumnentitel sind die Artikel-/Kapitelnamen, die oben oder unten auf der Seite mitlaufen. Auch da: Passen sie zum Inhaltsverzeichnis? Sind sie richtig geschrieben? Wechseln sie auch wirklich zu Beginn eines neuen Kapitels?
Schriftarten, Schriftgrößen
… sollten einheitlich sein. Auch in Zitaten im Magazin, die hervorgehoben sind. Oder beim Nennen der Autor:innen und Fotograf:innen. Oder in Überschriften, Zwischenüberschriften, Bildunterschriften. Womit wir schon beim nächsten Thema sind.
Bildunterschriften, Überschriften, Zwischenüberschriften
Eine der tragischen Wahrheiten ist: Diese Textarten sind das, was noch am ehesten gelesen wird. Wir alle überfliegen Texte, aber an diesen Eckpunkten halten wir uns in der Regel länger auf. Deshalb sollten die auch richtig geschrieben sein. Es sind also die einzigen Textarten, die man bei einer einfachen Fahnenkorrektur noch mal komplett lesen kann.
Wichtig ist ebenfalls: Passen die Bildunterschriften zu den Bildern? Sind die Bilder sinnvoll im Text platziert?
Immer dieser Kleinkram
Werden die Wortabstände irgendwo so eng, dass die ganze Zeile wie ein Bandwurmwort aussieht? Oder gibt es riesige Löcher? Sind die Einzüge einheitlich? Die Abstände der Absätze?
Dafür sorgen, dass die Herstellung einen nicht hasst
Gibt man die Korrekturen an jemand anders weiter, sind drei Punkte zentral.
1. Eindeutig markieren. Keine Sprechblasen im PDF, die verrutschen können.
2. Klappe halten. Nichts mit Worten erklären, was auch eine präzise Markierung erledigen kann. Nicht unnötig rechtfertigen. Änderungen, die oft wiederkehren, einmal erklären und dann nicht mehr (z. B. den Unterschied zwischen Binde- und Gedankenstrich).
3. Nur notwendige Korrekturen. Jetzt geht es nicht mehr um hübsche Formulierungen. Jede Änderungen verschiebt den Text. Heißt: Umbruch und Trennungen verrutschen. Heißt: eine neue Runde Fahnenkorrektur. Geändert wird also nur, was falsch ist.
Was ist der Unterschied zwischen Fahnenkorrektur und Schlussredaktion?
Manchmal werden die Begriffe synonym verwendet. Manchmal umfasst eine Schlussredaktion aber auch mehr als eine Fahnenkorrektur: Dann will der ganze Text noch mal gelesen und auf peinliche Fehler durchforstet werden. Am besten spricht man vorher ab, was gewünscht ist.
Viel Erfolg – und nicht vergessen: Pausen helfen bei der Konzentration. Eine Checkliste hilft beim Überblick.
Noch immer nicht genug? Mehr Tipps gibt es vorne im gedruckten Rechtschreibduden inkl. Korrekturzeichen (oder alternativ im PDF, das die HU Berlin rauskopiert hat). Für Profis winkt der Turtschi mit allem, was man über Typografie wissen kann: Zeichen setzen.
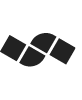




No Comments